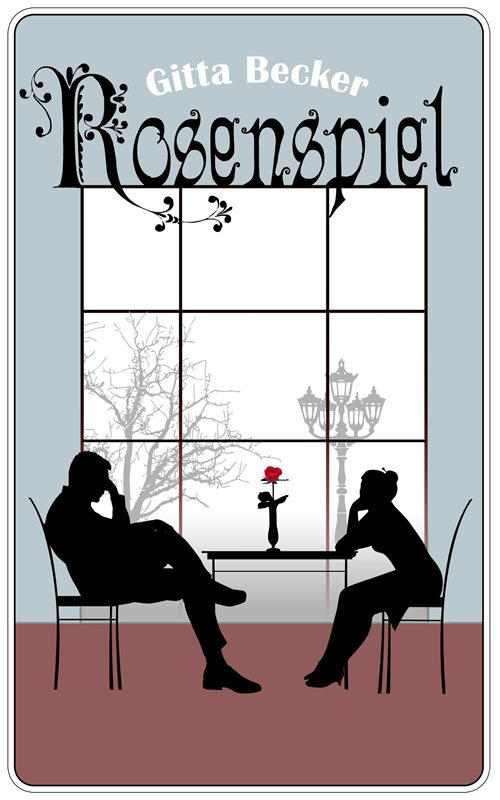Zehn Jahre
 Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Zehn Jahre, ein Wimpernschlag, so lang wie ein Sandkorn in einer Eieruhr von oben nach unten rieselt. Zehn Jahre sind so unendlich lang. Zehn Jahre ohne dich. Zehn Jahre in denen kein Tag vergangen ist und ich nicht an dich gedacht habe. Zehn Jahre Schmerz, der nicht wie die Trauer nachlässt oder gar vergeht. Der wird nur deswegen lebbar, weil man sich an ihn gewöhnt. Die Trauer zieht weiter, der Schmerz im Herzen bleibt. Zehn Jahre lang, zehn verdammte Jahre. Auf makabere Art und Weise ist der 28. Juli kein Datum, das ich mag. An diesem Datum ist Andreas zu einem Sternenkind geworden, drei Jahre zuvor ist meine Schwester voraus gegangen. Ich möchte dieses Datum aus dem Kalender streichen, überspringen und trotzdem bleibt er. Jedes Jahr.
Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Zehn Jahre, ein Wimpernschlag, so lang wie ein Sandkorn in einer Eieruhr von oben nach unten rieselt. Zehn Jahre sind so unendlich lang. Zehn Jahre ohne dich. Zehn Jahre in denen kein Tag vergangen ist und ich nicht an dich gedacht habe. Zehn Jahre Schmerz, der nicht wie die Trauer nachlässt oder gar vergeht. Der wird nur deswegen lebbar, weil man sich an ihn gewöhnt. Die Trauer zieht weiter, der Schmerz im Herzen bleibt. Zehn Jahre lang, zehn verdammte Jahre. Auf makabere Art und Weise ist der 28. Juli kein Datum, das ich mag. An diesem Datum ist Andreas zu einem Sternenkind geworden, drei Jahre zuvor ist meine Schwester voraus gegangen. Ich möchte dieses Datum aus dem Kalender streichen, überspringen und trotzdem bleibt er. Jedes Jahr.
Ich wurde von einer inzwischen verstorbenen Autorin, mit der ich Kontakt hatte und die, wie ich auch einen Sohn verloren hatte, mal gefragt wie das damals war, als er geboren wurde, krank wurde und schließlich als Sternenkind gegangen ist. Den nachfolgenden Text habe ich, auf ihre Bitte hin, vor acht Jahren geschrieben. Ich glaube noch bevor das „Gänseblümchen“ erschienen war. Da ist er dann der Hinweis auf das „Gänseblümchen“. Manchmal scheue ich mich für das Buch Werbung zu machen, aber dann denke ich, dass je mehr Menschen es lesen, desto mehr Menschen erfahren, was diese miese Krankheit für die Kinder bedeutet, was es für die Familien bedeutet, wobei wir noch gut dran waren, wenn ich über die anderen Kinder lese, aber trotz des ernsten Themas, verspreche ich, dass es nicht schwermütig ist, dass es mit einer ganzen Menge Humor gewürzt ist. Dravet Syndrom, wer kennt das schon? Es wird Zeit, es kennen zu lernen. Ich füge hier nicht alles ein, was ich dieser Autorin, deren Vorname Frauke war, geschrieben habe, wobei ich einiges auf Fehler und Formulierung korrigiert habe. Here we go:
(…)
Aber egal, er war da. Es war so schön, ihn zu riechen, zu fühlen, zu sehen und nach einem Kuss, auch zu schmecken. Es war alles perfekt, er war perfekt. Die Geburt haben wir beide überlebt, genau so muss man das nennen, Andreas entwickelte sich prächtig. Nichts schien unser Glück trüben zu können, bis er am ersten Weihnachtsfeiertag seinen ersten epileptischen Anfall hatte, damals noch getarnt als Fieberkrampf. Vorbei das Glück? Ein wenig schon, die Welt stürzte ein, drehte sich rückwärts, blieb scheinbar stehen. Angst war da. Panik ob der Frage „werden wir das schaffen? Können wir das schaffen?“ Es folgten Krankenhausaufenthalte, die mehr und mehr, eher weniger Erfolge brachten. Irgendwie schien ich den Eindruck hinterlassen zu haben, dass ich die Wahrheit nicht vertragen würde, obwohl ich sie längst und ziemlich früh erkannt hatte. Erst als ich wirklich drängte, da hat mir sein Neurologe reinen Wein eingeschenkt. Das hatte mir unglaublich geholfen, nicht mehr im Trüben zu fischen, endlich zu wissen, wo es lang ging. Die Jahre vergingen. Andreas war ein Lieber mit Ecken und Kanten, wie jeder Mensch sie hat, und doch hatte er auch die Fähigkeit, die alle Kinder haben: sie lehren uns Erwachsene manchmal Kind zu sein, rufen längst Vergessenes wieder wach. Behinderte Kinder, wie Andreas es war, lehren noch viel mehr: Geduld zu haben, das Leben zu schätzen, die Sonne zu sehen, auch wenn dicke Regenwolken am Himmel stehen, das Leuchten der Blumen wahrzunehmen und den Winter nicht als das Ende der Welt, sondern die Zeit vor einem neuen Anfang zu sehen. Er war so unendlich geduldig, klagte nie, egal wie er sich fühlte, einzig daran, ob er ein wenig missmutig gelaunt war, konnte man einen nahenden Anfall erkennen. Er hatte immer Anfälle, frei von Anfällen war er nie über sehr lange Zeit.
Mit fast 17 Jahren ist er in einen Einrichtung ausgezogen, die zu seiner zweiten Familie geworden war. Das war eine meiner besten Entscheidungen für ihn. Er fand dort einen Freund, der auch am Abend da war, am Samstag und auch am Sonntag, wenn Andreas diese Tage nicht bei uns verbracht hatte. Er verliebte sich dort, lernte das Gefühl kennen, Schmetterlinge im Bauch zu haben, lächelte immer ein wenig verschmitzt und wurde rot, wenn wir ihn darauf angesprochen haben. Ich betrachtete es nicht am Ende nicht als eine Niederlage, dass er ausgezogen war, am Anfang dagegen schon. Ihn sein Leben unter Menschen leben zu lassen, die wie er ihre eigene Welt, ihre eigene Hierarchie, ihre eigene Ordnung haben, war gut. In dieser Welt können wir uns nicht integrieren, werden immer Außenstehende sein. Er lebte nicht mehr bei mir, die Verantwortung für ihn, die aber blieb bei mir.  Dann kam dieser Tag, von dem ich immer wusste, dass er kommen würde, aber niemals gedacht hätte, dass es an diesem Tag geschehen würde. Ich hatte geduscht und mit einem wohligen Kribbeln im Bauch dachte ich an meinen Sohn. Kaum war ich aus der Dusche, hatte mich entsprechend der heißen Temperaturen angezogen, war noch gegenüber an der Tankstelle gewesen, um Zeitungen zu kaufen, da läutete das Telefon, kaum als ich zurück war. Ich hörte aus weiter Ferne die Stimme des Heimleiters, dass wir sofort kommen müssen, die Feuerwehr sei da und der Notarzt würde versuchen ihn zu reanimieren, es sähe nicht gut aus. War er das schon dieser Tag, den ich immer kommen sah und vor dem ich mich dennoch immer gefürchtet habe? Konnte ich das mir selbst gesteckte Ziel, ihn niemals leiden zu lassen, erreichen, oder würde ich es aufgeben, weil ich Andreas, aus reinem, eigenem mütterlichen Egoismus nicht gehen lassen wollte, um diese entsetzliche Trauer, die der Verlust eines Kindes mit sich bringt, nicht leben und nicht fühlen zu müssen? Ich erinnerte mich sehr meine Mutter beim Tod meines Bruders und Jahre später beim Tod meiner Schwester gelitten hat. Hatte ich nicht noch am Abend zuvor mit meinem fröhlichen Andreas wie jeden Mittwoch telefoniert? So geduldig es ging, seine immer gleichen Fragen beantwortet? Ihn gelobt, weil er voll Stolz davon erzählt hatte, wie gut er beim Sport, bei der ihm verhassten Krankengymnastik, mitgemacht hatte? Hatten wir uns nicht für das kommende Wochenende verabredet, dass ich ihn abhole und wir es uns gemütlich machen wollten?
Dann kam dieser Tag, von dem ich immer wusste, dass er kommen würde, aber niemals gedacht hätte, dass es an diesem Tag geschehen würde. Ich hatte geduscht und mit einem wohligen Kribbeln im Bauch dachte ich an meinen Sohn. Kaum war ich aus der Dusche, hatte mich entsprechend der heißen Temperaturen angezogen, war noch gegenüber an der Tankstelle gewesen, um Zeitungen zu kaufen, da läutete das Telefon, kaum als ich zurück war. Ich hörte aus weiter Ferne die Stimme des Heimleiters, dass wir sofort kommen müssen, die Feuerwehr sei da und der Notarzt würde versuchen ihn zu reanimieren, es sähe nicht gut aus. War er das schon dieser Tag, den ich immer kommen sah und vor dem ich mich dennoch immer gefürchtet habe? Konnte ich das mir selbst gesteckte Ziel, ihn niemals leiden zu lassen, erreichen, oder würde ich es aufgeben, weil ich Andreas, aus reinem, eigenem mütterlichen Egoismus nicht gehen lassen wollte, um diese entsetzliche Trauer, die der Verlust eines Kindes mit sich bringt, nicht leben und nicht fühlen zu müssen? Ich erinnerte mich sehr meine Mutter beim Tod meines Bruders und Jahre später beim Tod meiner Schwester gelitten hat. Hatte ich nicht noch am Abend zuvor mit meinem fröhlichen Andreas wie jeden Mittwoch telefoniert? So geduldig es ging, seine immer gleichen Fragen beantwortet? Ihn gelobt, weil er voll Stolz davon erzählt hatte, wie gut er beim Sport, bei der ihm verhassten Krankengymnastik, mitgemacht hatte? Hatten wir uns nicht für das kommende Wochenende verabredet, dass ich ihn abhole und wir es uns gemütlich machen wollten?
Nun saß ich auf dem Beifahrersitz im Auto ohne Tasche, ohne Papiere, ohne Haustürschlüssel, ohne Handy, mit nichts, rief über das Handy seines Vaters seine Schwestern an, dass wir gerufen worden seien. Ich bin oft gerufen worden, wenn er während eines Anfalls gestürzt war und sich so verletzt hat, dass er ärztlich versorgt werden musste. Nie hatte ich Zweifel daran, dass alles gut werden würde. Nicht so an diesem Morgen. Auf dem Weg, ich weiß noch genau die Stelle und fahre deswegen diese Straße nur selten, hörte ich auf mein Kind zu fühlen, das wohlige Kribbeln von vorhin unter der Dusche, das mich bis zu dieser Stelle begleitet hatte, war einer inneren Leere gewichen. Stille. Leere. Nichts war mehr in mir, kein Gefühl mehr, dass er noch da ist. Ich wusste, er war gegangen.
Angekommen in der Einrichtung, aus dem fast noch fahrenden Auto gesprungen, am Portier vorbei, an der ersten Wohngruppe vorbei, der zweiten vorbei, einen nicht enden wollenden Gang entlang, von dem ich mir wünschte, dass er niemals enden würde, erreichte ich seine Wohngruppe dennoch. Hier vorbei an den Feuerwehrleuten, die nichts zu tun hatten, den Betreuern, dem Heimleiter, in deren Gesichtern, was ich nie wieder vergessen werde, das blanke Entsetzen stand, hinein in sein Zimmer und da lag er. Ich beschreibe dies Bild nicht, ich lasse es da, wo es hingehört: in mir, meinem Herzen, meinen Gedanken. Ich höre den Heimleiter zum Notarzt sagen „Das ist seine Mutter“ und sehe den Notarzt, wie dieser ansetzt, um mir eine Erklärung geben zu wollen. Ich unterbreche ihn und frage ihn, wie lange er mein Kind schon reanimieren würde. Nach der Antwort es wären jetzt 45 Minuten, ließ ich alle Maßnahmen sofort einstellen. Nein, das muss nicht sein. Mein Gefühl hat mich nicht betrogen. Die Stille, die ich fühlte, die Leere um Andreas, die mich nun immer begleiten wird, waren real gewesen. Einzig die Liebe für ihn und die Erinnerung an ihn werden mir und uns allen immer bleiben, das kann mir niemand nehmen.
Wir, eine seiner Schwestern war inzwischen mit ihrem Freund eingetroffen, baten darum mit ihm alleine sein zu dürfen. Wir beginnen, nachdem alle den Raum verlassen haben, Abschied zu nehmen, lassen zu, dass sich Mitarbeiter, die ihn gut gekannt haben, im Laufe der folgenden Stunden von Andreas verabschieden können, bis er, beschlagnahmt durch die Staatsanwaltschaft, abgeholt wurde. Dort, wo er seine zweite Familie gefunden hatte, erfahren wir Trost, spenden Trost, trauern gemeinsam. Schwer, verdammt schwer! Was soll man einer Mutter, einem Vater, einer Schwester sagen, deren Kind und Bruder gerade gegangen war? Nichts kann trösten, gut gemeinte Worte wie „die Zeit heilt Wunden“ kommen nie so an, wie sie gemeint sind. Wir sind ungerecht jenen gegenüber, die uns trösten wollen und doch helfen ihre Worte, wenn man sie zulassen kann. Andreas war abgeholt, auch wir gehen nach Hause und wissen, dass wir, egal wo wir später anrufen werden, Entsetzen verbreiten werden, bei unserer Verwandtschaft, unseren Freunden und Bekannten.
Noch bevor wir es selbst fassen und verstehen können, meldet sich das Bestattungsinstitut an. Ich hasse sie, die Frau die uns da gegenüber sitzt. Sie kann nichts dazu. Wie kann ich, wie können wir alle jetzt einen Sarg und Blumen aussuchen, wenn wir das eben Erlebte noch gar nicht begriffen haben? Wenn wir noch nicht verstehen, dass sein Platz für immer leer bleiben wird. Niemand setzt sich auf seinen Stuhl, es war, als würde er sich gleich kommen und sich hinsetzen wollen. Wir sitzen später noch zusammen, bestellen Pizza, die er so gerne mochte, rühren sie kaum an, werfen sie am Ende weg, reden über Andreas. Alles, was uns einfällt. Ich bin müde, ich kann nicht mehr und ziehe mich zurück, gehe schlafen. Ich schlafe weinend ein und wache drei Stunden später weinend wieder auf. Ich kann nicht mehr schlafen, als ich aufstehen will, schmerzt jede Faser meines Körpers, ich könnte vor Schmerzen aufschreiben. Ich mache mir Tee und weine weiter. Das geht die nächsten Tage so.
Die Trauerfeier kommt unaufhaltsam näher. Der Besuch beim Pfarrer steht an, ein dufter Typ, der uns so viel geholfen hat. Die Verwandten reisen nach und nach an. Stumm, sprachlos, was sollen sie auch sagen? Ich wünsche mir, dass wir uns nach der Trauerfeier nach Hause zurückziehen, möchte in kein Café, kein Restaurant gehen. Ich beginne das Haus dafür zu putzen, obwohl ich das hasse, aber ich muss etwas tun, kann nicht still sitzen. Immer noch lässt mich jede Faser meines Körpers schmerzvoll fühlen, dass ich da bin, wo ich gerade nicht sein will. Der Tag an dem wir Abschied nehmen, war da. Andreas liebte alles, was mit Kirche und Pfarrer zusammenhing. Der Pfarrer seiner Gemeinde ist ein Segen für uns alle, findet unvergleichlich tröstende Worte, Liebe, Glaube, Hoffnung, Andreas liebte die Farbe „Grün“, wir, seine Familie, tragen alle etwas Grünes, der Pfarrer sah es und baute es in seine Rede ein. Dann war plötzlich ein Schmetterling da, der sich auf den Blumenschmuck seines Sarges setzte, danach eine Runde flog und sich dann zu unseren Füssen, genau in die Mitte vor uns, niederließ. Ich habe ihn gesehen, alle anderen auch. Wir überstehen die Trauerfeier, wie alle Menschen das irgendwie immer tun.
Am nächste Tag beginnt dann das erste Jahr danach, das erste Jahr in neuer Zeitrechnung. Das erste Jahr ohne ihn, ohne meinen Andreas. Ohne sein Lachen. Ohne das Erdbeben, das er stets verursachte, wenn er ungelenk durch seine körperliche Behinderung in freudiger Begrüßung auf mich zugebebt kam. Ohne seine Umarmungen, die mir immer die Luft nahmen, weil er seine Kraft nicht dosieren und kontrollieren konnte. Ohne seine nassen, klebrigen, nassen Küsse mit und ohne Nutella. Ohne die vielen Fußballbilder, die immer um ihn herumlagen. Ohne so Vieles mehr, das er uns allen gegeben hat. Wir fliehen, als der erste Geburtstag ohne ihn stattfinden sollte. Seine große Schwester bat uns, ob wir nicht wegfahren könnten, wenigstens an diesem Tag. Wir machen ein ganzes Wochenende daraus. Es tut uns gut. Es kommt das erste Weihnachtsfest, wir können nicht nochmals fliehen. Die grüne Uhr, die er sich das Jahr zuvor noch gewünscht und auch bekommen hat, liegt vor seinem Bild. Es tut weh, aber wir begehen das Weihnachtsfest wie immer, als wäre Andreas noch da. Niemand möchte sich auf seinen Platz setzen, immer noch nicht. Das neue Jahr beginnt, mein Geburtstag kommt. Mein erster in der neuen Zeitrechnung. Ich bin noch einmal geboren, aber ich bin nicht mehr vollständig, etwas fehlt. Ich hatte eine große Feier geplant, hatte ich doch eine „runde“ Zahl vor mir. Wir verkleinern die Feier, sind mit den Freunden zusammen, die uns bis jetzt durch diese Zeit begleitet hatten. Man braucht Freunde, jeder braucht sie. In Notsituationen zeigt sich immer, wer die wahren Freunde sind. Unsere Freunde sind von uns einiges gewöhnt, sind kampferprobt, gehen mit uns auch diesen Weg. Danke dafür. Das ist nicht selbstverständlich.
Andreas erster Geburtstag ohne ihn kommt. Ich fange nicht einen Tag davor an, seinen Kuchen zu backen, stattdessen gehe ich zum Friedhof, richte sein Grab her, mache es gemeinsam mit seiner „kleinen“ Schwester schön. Ich backe seinen Lieblingskuchen, der auch Lieblingskuchen seiner Geschwister ist, nicht. Backe ihn für mehr als ein Jahr nicht mehr, kann es einfach nicht. Sein Geburtstag geht vorbei, wir sitzen zusammen, reden über ihn, als wäre er noch da. Niemand mag es annehmen, dass er es nicht mehr ist. Es ist, als müsse es jeden Moment an der Tür läuten, der Hund bellen und seine unüberhörbare Stimme rufen „Hallo Leute, da bin ich doch!“.
(…)
Der Kreis schließt sich, der 28. Juli kommt, der Tag, der unsere neue Zeitrechnung beginnen ließ. Ich habe mich während der vergangenen Jahre unzählige Male gefragt, ob meine Entscheidung richtig war, die Reanimation sofort einstellen zu lassen. Mein Verstand sagt ja, mein Herz schilt mich gelegentlich immer noch und dann haben Verstand und Herz Streit, sie reden dann für ein paar Stunden nicht miteinander. Mein Schmerz und meine Trauer wie fühlen sie sich an? Die Trauer wiegt nicht mehr so schwer, weil wir uns an die schönen Momente erinnern wollen, an das, was er uns gegeben hat und nicht an das, was wir verloren haben. Der Schmerz ist immer noch da, der wird wohl bleiben, ist mal besser und mal schlechter lebbar. Es wird nie wieder so sein, wie es war. Jetzt sind das zehn Jahre. Immer noch denke ich jeden Tag an Andreas. Ich kann nicht anders. Er ist jetzt Onkel, zwei Nichten hat er und er wäre ein guter Onkel, einzig die grünen M&Ms würde er auch nicht an seine Nichten abgeben, aber er würde mit ihnen Fußballbilder kleben, oder wenn sie älter sind, sie mit ihm. Er wäre, oh mein Gott, jetzt schon 35 Jahre alt und würde seufzend dazu sagen: „Kinder wie die Zeit vergeht!“. Ob er … nein, ich will nicht darüber nachdenken, was das Dravet-Syndrom ihm noch alles angetan hätte, wenn das/der SUDEP nicht gekommen wäre. Solche Gedanken verbieten sich zum Ausmalen, helfen aber dabei miese Stunden besser zu überstehen, weil man sich vormachen kann, dass es so, wie es gekommen ist, irgendwie gut war. Gut? Was kann, und das war die Ursache seines Todes, an einem verdammten Dravet-Syndrom gut sein? Es gibt sie auch nach zehn Jahren immer noch, diese miesen Tage an denen ich nicht über Andreas reden oder schreiben kann, ohne Tränen in den Augen zu haben und wie ein Mädchen zu heulen, aber dann sage ich mir: Aufstehen, Krönchen richten und weiter nach vorne gehen. Das ist nun mal so, damit muss ich leben, damit müssen wohl alle Mütter, Väter leben, deren Kinder vor ihnen gegangen sind. Zehn Jahre vorbei, let’s go in die nächsten zehn Jahre!